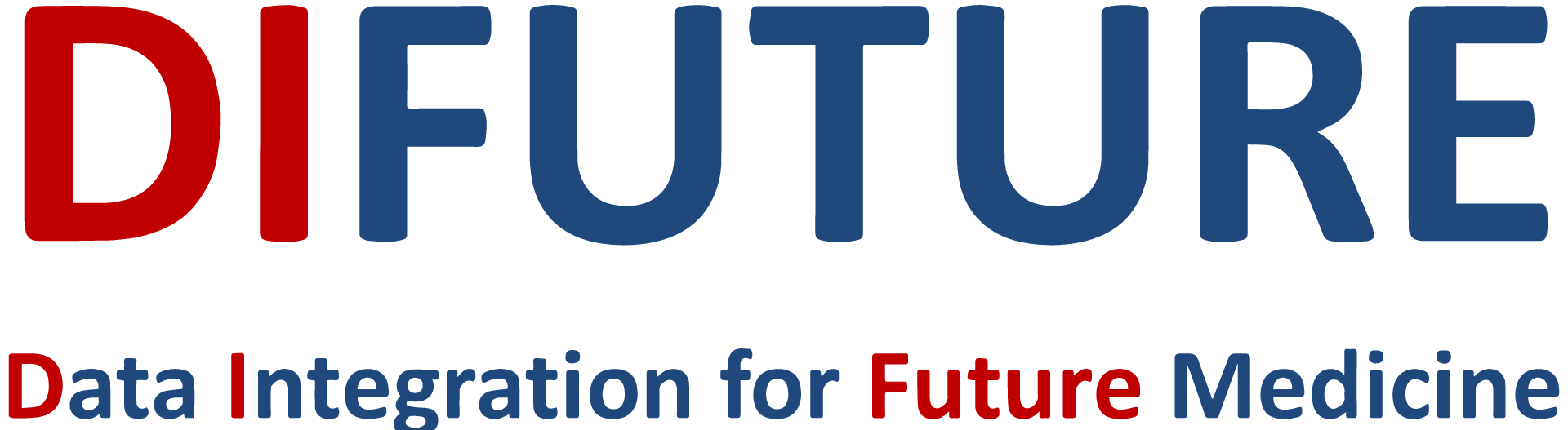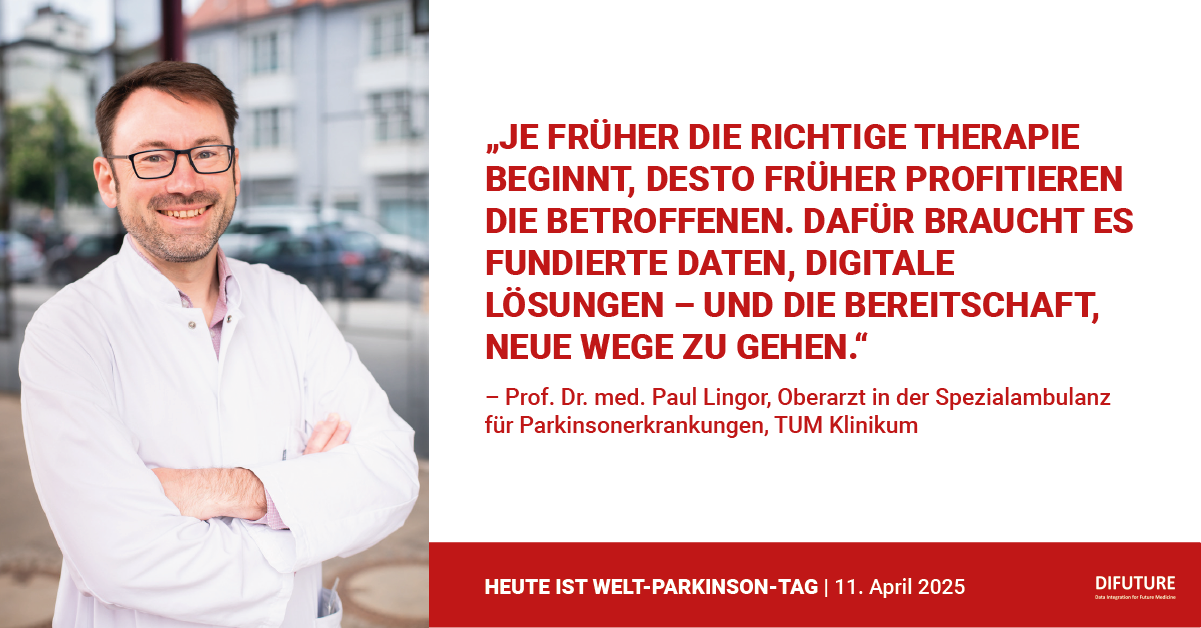Für viele Menschen mit fortgeschrittener Parkinson-Erkrankung gehört das zum Alltag. Während medikamentöse Therapien anfangs oft gut wirken, stoßen sie mit der Zeit an ihre Grenzen. Nicht-orale Folgetherapien (NOFT) wie tiefe Hirnstimulation, Pumpensysteme oder fokussierter Ultraschall können helfen – werden jedoch oft zu spät in Erwägung gezogen.
Warum? Unter anderem, weil es an verlässlichen Daten fehlt, wann und für wen diese invasiveren Verfahren der richtige Schritt sind. Innerhalb der Medizininformatik-Initiative (MII) engagieren wir uns bei DIFUTURE gemeinsam mit Prof. Dr. Lingor für ein deutschlandweites Parkinson-Register: RAP-PD. Ziel ist es, mit Hilfe strukturierter Daten und einer standardisierten Dokumentation mehr Evidenz über NOFT zu generieren.
Zum Welt-Parkinson-Tag haben wir mit Prof. Dr. Paul Lingor, Neurologe am TUM Klinikum Rechts der Isar darüber gesprochen, warum Aufklärung, Vernetzung und strukturierte Daten zentrale Hebel für eine bessere Versorgung sind – und wie RAP-PD dazu beitragen will, Versorgungslücken zu schließen.
Was ist Parkinson?
Morbus Parkinson ist eine chronische Erkrankung des Gehirns, bei der bestimmte Nervenzellen – sogenannte dopaminerge Neurone – absterben. Auch wenn die Krankheit heute noch nicht heilbar ist, gibt es bereits jetzt viele wirksame Therapien, die den Alltag erleichtern und die Lebensqualität verbessern.
Woran erkennt man erste Anzeichen?
Typisch sind verlangsamte Bewegungen, manchmal auch das Zittern einer Hand in Ruhe. Aber auch unspezifische Symptome wie eine leise Stimme, depressive Verstimmungen, Störungen des Geruchssinns oder Schlafstörungen können frühe Hinweise sein. Wichtig ist: Je früher die richtige Therapie beginnt, desto mehr profitieren die Patienten. Dafür braucht es fundierte Daten, digitale Lösungen – und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen.
Mit welchen Herausforderungen sind Sie in der Behandlung von fortgeschrittener Parkinson-Erkrankung im Alltag konfrontiert?
In den ersten Jahren der Erkrankung helfen eine Reihe von Medikamenten, die beispielsweise als Tablette eingenommen werden können, sehr gut, vor allem, um die Beweglichkeit zu verbessern. Auch Physiotherapie ist hier sehr wichtig. Aber je länger die Erkrankung dauert, desto unzuverlässiger wird die Wirkung. Die Beweglichkeit kann im Tagesverlauf sehr schwanken, selbst wenn die Medikamente richtig eingenommen werden. Zudem können auch andere Symptome dazukommen, beispielsweise Schlaf-, Schluck- oder auch Gedächtnisstörungen. Diese sogenannten „nicht-motorischen Symptome“ sind oft besonders schwer zu behandeln.
Welche Rolle spielen NOFT in Ihrer klinischen Praxis?
Diese Verfahren kommen meist in den fortgeschrittenen Stadien zum Einsatz und gehen über eine Tablettentherapie hinaus. Sie sind mit einem größeren technischen Aufwand verbunden, wie beispielsweise eine Operation oder dem Einsatz von Medikamentenpumpen. Wir wissen, dass diese Therapien sehr wirksam sind, aber der Aufwand schreckt viele PatientInnen ab. Daher ist es wichtig, frühzeitig über diese Möglichkeiten zu informieren und die PatientInnen in den Entscheidungsprozess einzubeziehen.
Wann ist aus Ihrer Sicht der richtige Zeitpunkt für eine NOFT?
Das ist ja gerade das Problem: den exakt richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Ein grober Anhaltspunkt ist, wenn jemand mehr als viermal täglich Tabletten nehmen muss – dann sollte man eine kontinuierliche Therapien wie eine Pumpe oder eine tiefe Hirnstimulation in Erwägung ziehen. Viele PatientInnen zögern – aus Angst vor Eingriffen oder Technik. Umso wichtiger ist es, frühzeitig und ehrlich über diese Optionen zu sprechen.
Welche Informationen fehlen Ihnen derzeit bei der Therapieplanung oder im Verlauf?
In vielen Fällen könnten für einen Patienten verschiedene Therapien in Frage kommen. Hier könnten uns prospektive Daten helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch besser einzugrenzen, wann der beste Zeitpunkt für die Einstellung auf eine solche Therapie ist. Auch NOFT haben im Verlauf Grenzen ihrer Wirksamkeit oder Nebenwirkungen – auch hier wäre eine bessere Datenbasis aus prospektiven Studien sehr wichtig, um fundiert über Therapiewechsel oder -kombinationen entscheiden zu können.
Wie kann ein Register wie RAP-PD helfen, die Versorgungssituation für Parkinson-PatientInnen zu verbessern?
Ein Register sammelt Daten von PatientInnen, die aktuell behandelt werden, d. h. es spiegelt die Behandlungsrealität ganz anders wider, als es im Rahmen einer klinischen Studie untersucht werden kann. Diese Daten helfen uns, die Realität besser zu verstehen und damit auch klinische Studien gezielter zu planen.
Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die Medizininformatik bei der zukünftigen Therapieentscheidung?
Der Wert der Medizininformatik kann gar nicht überschätzt werden, denn nur mit einer qualitativ hochwertigen Datenerfassung und -auswertung können fundierte Aussagen getroffen werden. Die Medizininformatik schafft die Strukturen dafür – und trägt dazu bei, komplexe Datensätze in verständliche und medizinisch relevante Antworten zu übersetzen.
Wie wichtig ist der Austausch zwischen verschiedenen Zentren im Umgang mit komplexen Parkinson-Verläufen?
Am Register sollen zahlreiche Zentren in ganz Deutschland beteiligt werden. Viele dieser Zentren haben auch selbst ein ausgesprochenes Forschungsinteresse an fortgeschrittenen Stadien der Parkinsonerkrankung. Insofern können Daten aus dem Register auch im Rahmen gemeinsamer Projekte genutzt werden. Regelmäßige Treffen aller Projektpartner werden dazu dienen, sich über gemeinsame Fragestellungen und ihre Lösung im Rahmen von RAP-PD auszutauschen.
Was erwarten Sie sich persönlich von der Beteiligung am RAP-PD-Register?
Neben dem wissenschaftlichen Nutzen freue ich mich besonders auf den persönlichen Austausch mit zahlreichen KollegInnen und das Diskutieren gemeinsamer Forschungsprojekte. Das Register kann als Grundlage für viele weitere Forschungsprojekte im Bereich der fortgeschrittenen Parkinsonerkrankung dienen.
Wenn Sie einen Wunsch an die Forschung oder Politik richten könnten – was müsste sich verbessern, um Parkinson-PatientInnen besser zu versorgen?
Vernetzung, Digitalisierung und Finanzierung von Forschung zu ursächlichen Therapien sind die für mich wichtigsten Stichpunkte. Netzwerke, die die zahlreichen an der Therapie von ParkinsonpatientInnen Beteiligten zusammenbringen, können einen Mehrwert schaffen. Dazu braucht es digitale Tools für den Datenaustausch. Das RAP-PD-Register ist da ein gutes Beispiel. Andererseits ist die Entwicklung von krankheitsmodifizierenden Therapien, die die Ursache der Erkrankung behandeln, sehr wichtig. Hier müssten deutlich größere Anstrengungen im Sinne von Forschungsförderung unternommen werden, damit die Entwicklung neuer Medikamente vorangetrieben werden kann. Auch wir arbeiten in klinischen Studien an der Entwicklung solcher Substanzen.
Was gibt Ihnen Hoffnung im Umgang mit dieser Erkrankung – für Ihre PatientInnen, aber auch für Sie als Arzt?
Parkinson ist heute besser behandelbar als viele andere neurodegenerative Erkrankungen. Das zunehmende Verständnis der Krankheitsursachen und die positiven Beispiele der letzten Jahre bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen nähren die Hoffnung, dass wir in den nächsten Jahren noch viel mehr für unsere PatientInnen tun können.
Wir bedanken uns herzlich bei Prof. Dr. Paul Lingor für das Gespräch – und bei allen, die sich Tag für Tag für mehr Lebensqualität und eine bessere Zukunft von Menschen mit Parkinson engagieren.